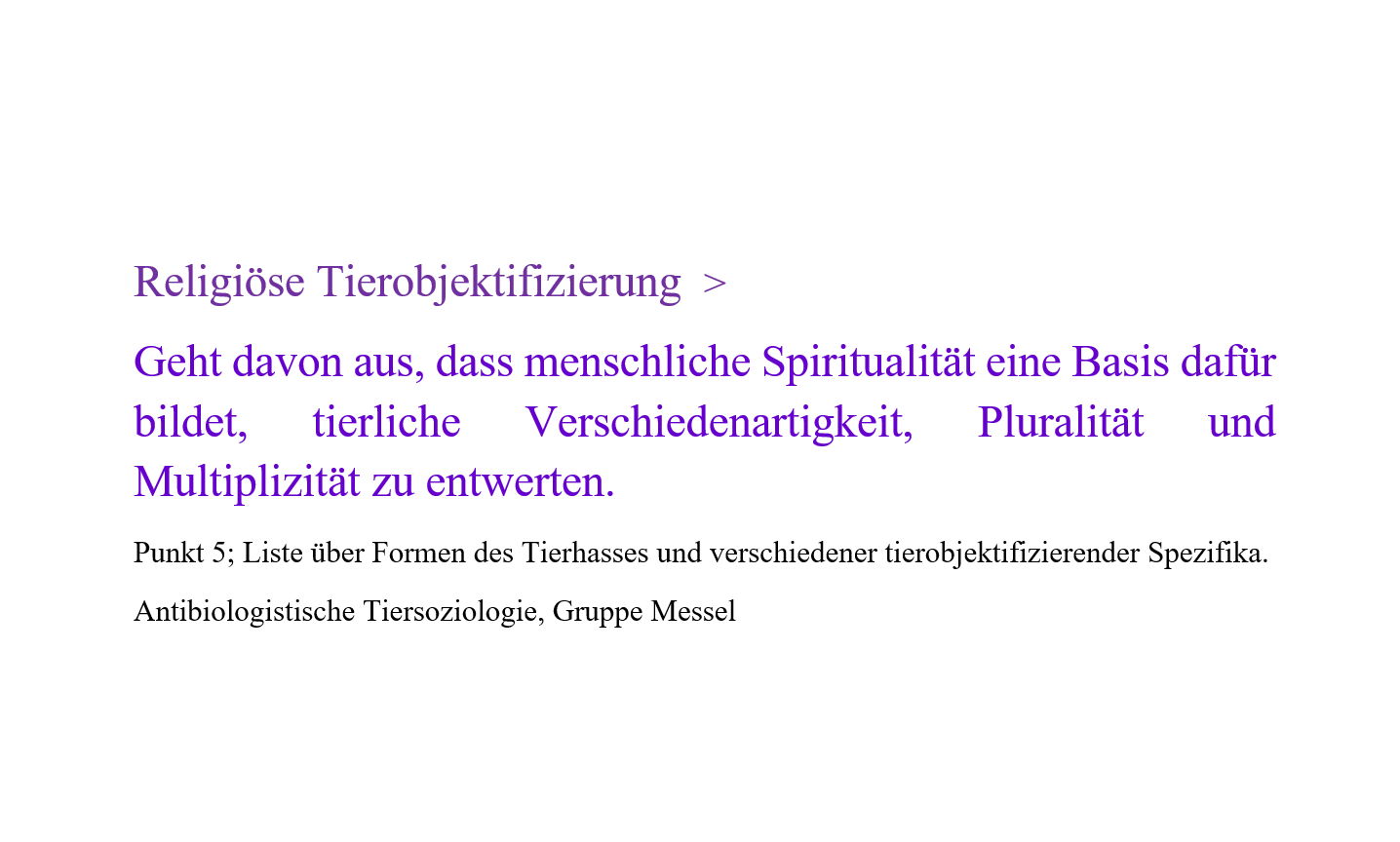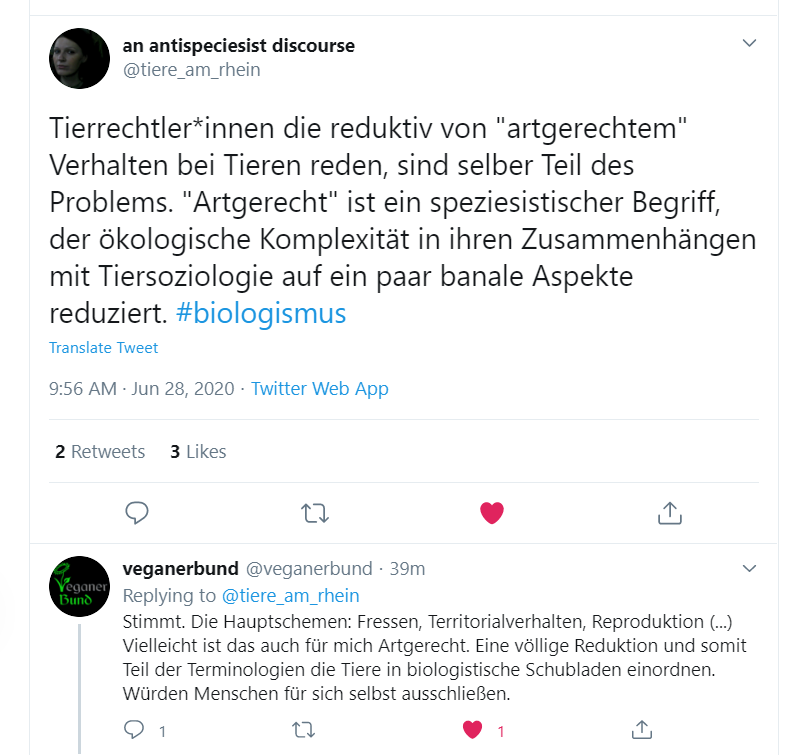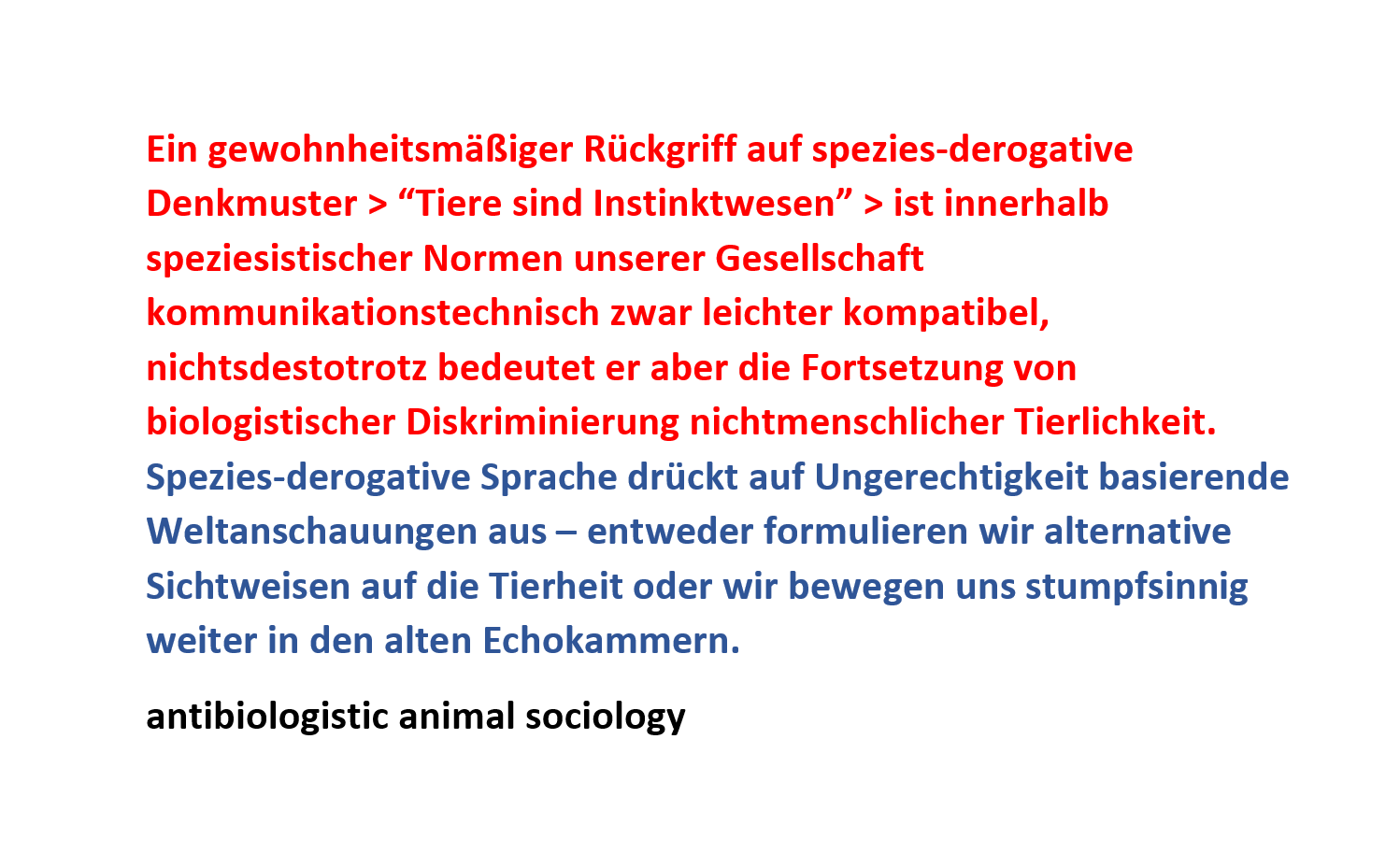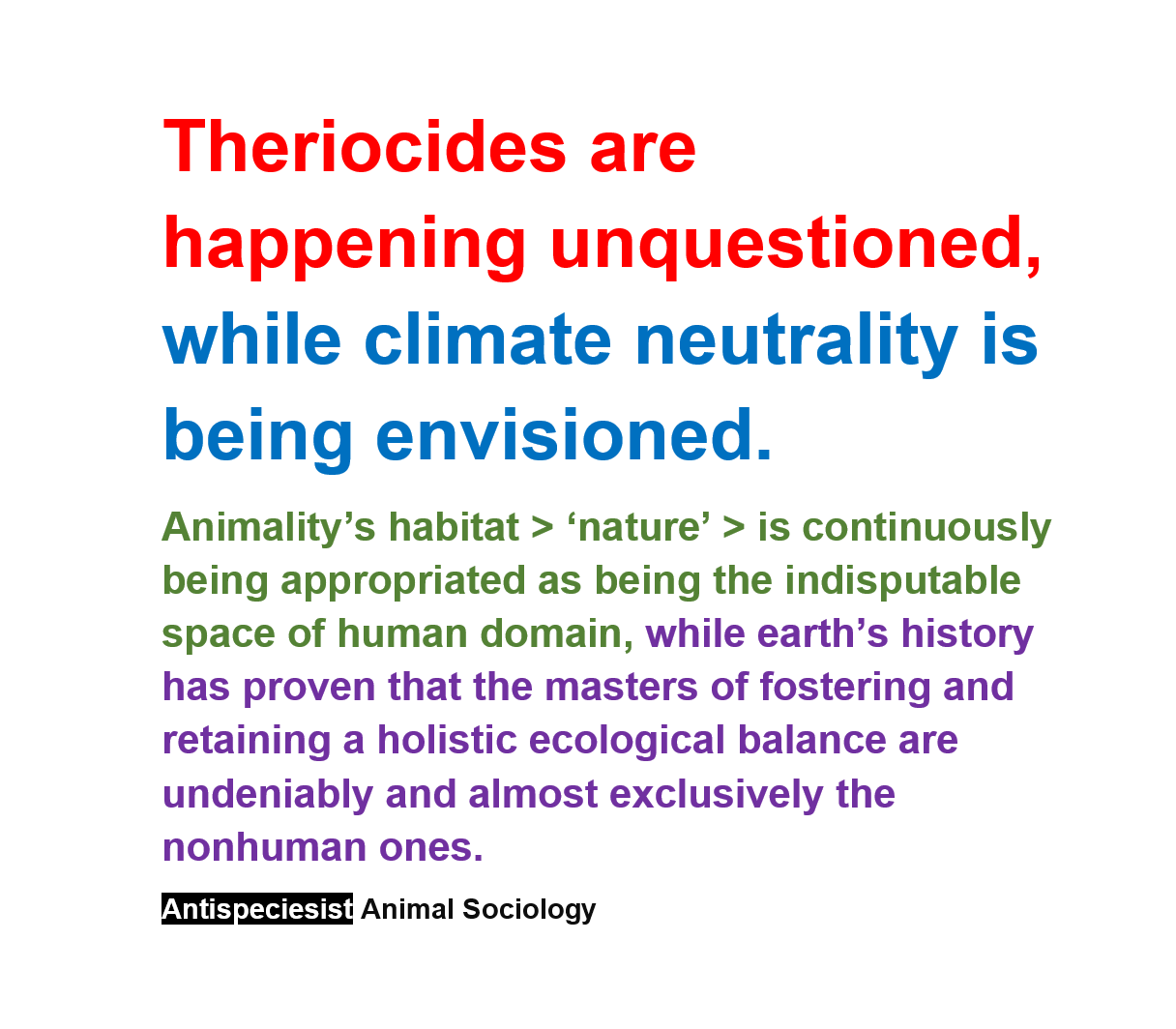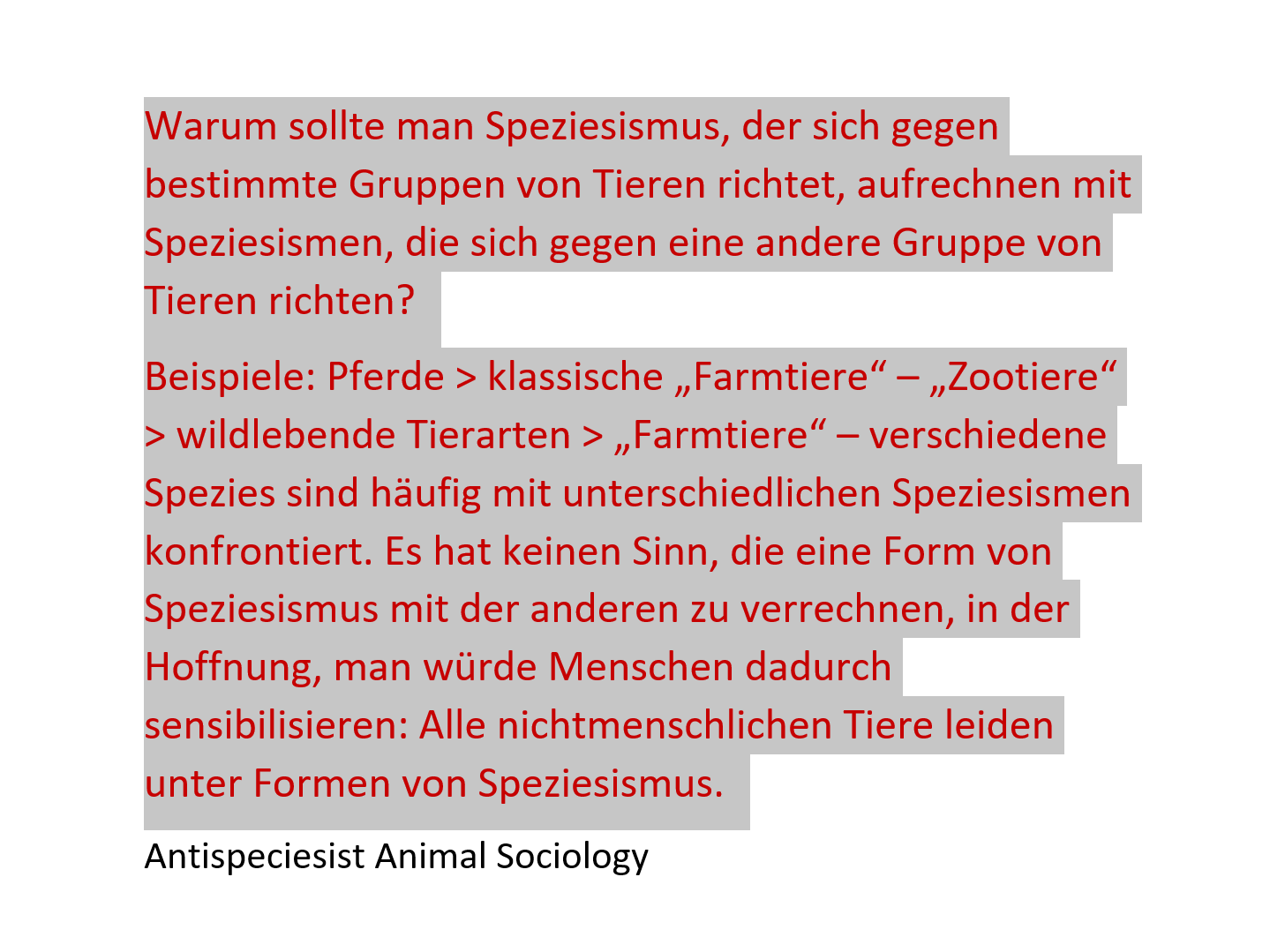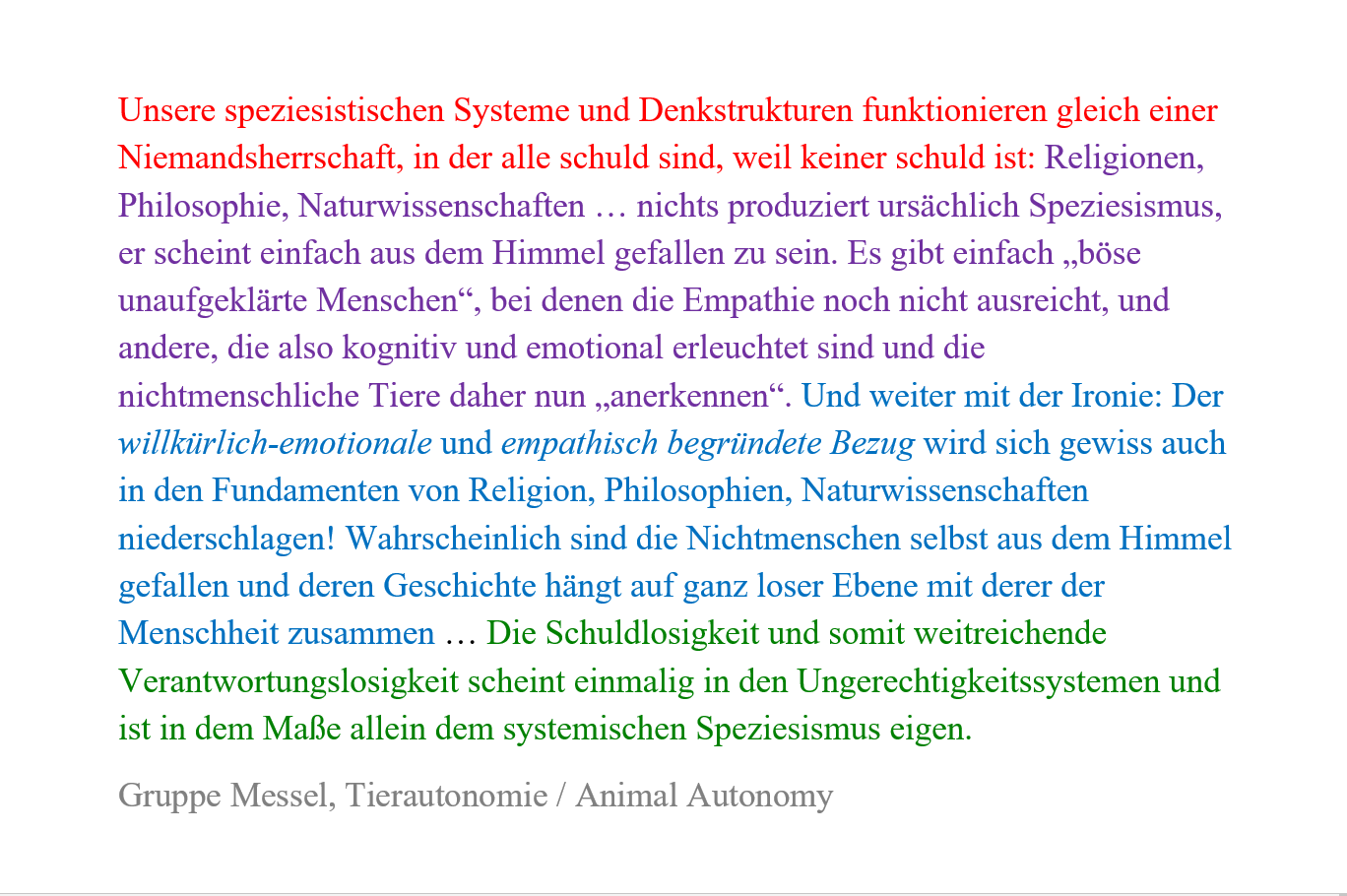Skythen mit Pferden unter einem Baum. Goldene Gürtelplakette. Sibirien, 4.-3. Jahrhundert v. Chr. © Staatliches Eremitage-Museum, St. Petersburg, 2017. Foto: V. Terebenin > https://www.britishmuseum.org/blog/introducing-scythians [15.01.2024]
Wenn Sie sich für tiermythologisch- und in dem Zusammenhang ziersoziologische Inhalte interessieren:
Tiersoziologie und Literatur > https://simorgh.de/about/houser-erzaehlliteratur-ist-aktivismus/ , bezugnehmend auf Tolstoi > und Dostojewski > Animal Portrayals in Literature: The Mare and Raskolnikov’s dream > https://simorgh.de/niceswine/the-mare-and-raskolnikov ; siehe auch > Animal Portrayals: in History and Literature, Pit Pony and from Germinal by Émile Zola, Chapter 5: The Horses Trompette and Bataille – die Pferde in Zolas Germinal > https://www.simorgh.de/objects/pit-pony-trompette-and-bataille/ ; allgemein ist aus der klassischen Literatur auch Aitmatow (Kirgisien) für die wertschätzende sensible Auseinandersetzung mit der sozialen Beziehung zwischen Menschen und Pferden bekannt. Auch in der persischen Mythologie trägt die Beziehung des Erkenntnishelden Rostam mit seinem treuen Pferd Rashn eine besondere und höchst mythologische Bedeutung im Schahnahmeh. Ich glaube man muss nicht erklären, in welcher Korrelation eine konstruktive und positive soziale Bezugnahme zur einer destruktiv-herabwürdigenden In-Bezugsetzung in diesen Kontexten steht.
Allgemein für den Tierrechtsdiskurs:
Und auf welche Weise würdigen Sie die Pferde herab?
Thema: Reitsport, Dressur. Nicht vereinbar mit Tierrechten.
Da es längst überfällig ist im Rahmen unseres Beitrag zu > Veganismus, Antispeziesismus und Reiten > wegen der allgemeinen Situation der Pferde und ihrer Art der Betroffenheit durch Speziesismen zu schreiben, werde ich hier eine Quellen [und in Zukunft vermutlich weitere Quellen] zitieren, sie sich mit dem Thema Dressurreiten genauer auseinandergesetzt haben.
Ich beginne mit einem Artikel der Journalistin https://twitter.com/SarahNEmerson, welcher natürlich auch weiterführende Links enthält > https://www.vice.com/en/article/mg75jx/why-is-dressage-still-an-olympic-sport-equestrian [Zugriff 15.01.24].
Da sich an der Situation bislang eigentlich garnichts verändert, weil die reitende Lobby solch eine wirklich erschreckend dominante Haltung einnimmt gegenüber Pferden und Tierrechten – die man entweder nicht versteht, verstehen will oder einfach unumwunden ablehnt, da man sich als Tierversteher aufführen möchte – können wir uns hier auch getrost mit einem Artikel aus dem Jahr 2016 befassen, als weiterhin aktuell beiträglich für die kritische Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex.
Für wirkliche Pferdefreunde und andere echte Antispeziesisten hört das Thema auch nicht auf mit ganz weit oben auf der Liste der zu adressierenden tierobjektifizierenden Problematiken in unserer Gesellschaft zu stehen.
Sarah N. Emerson: Warum ist Dressur immer noch ein olympischer Sport? Ist “Pferdeballett” cool oder grausam?
“Why Is This Still a Thing” ist eine Kolumne [in dieser Kolumne erschien der Artikel], die sich mit anachronistischer, scheinbar überholter Technologie beschäftigt, die uns allseitig umgibt.
Es gibt Sportarten, bei denen man den menschlichen Körper und seine außergewöhnlichen Fähigkeiten bewundern kann – Tauchen, Turnen oder der 400-Meter-Lauf. Und dann ist da noch die Dressur, auch bekannt als “Pferdeballett” (engl. horse ballet). Warum gibt das Dressurreiten überhaupt noch? Die Dressur ist wahrscheinlich die schlimmste olympische Sportart, und sie ist eindeutig auch grausam.
Keine andere Veranstaltung macht mich so wütend wie die Dressur. Das Internationale Olympische Komitee beschreibt sie als “die Essenz der Partnerschaft, wenn Reiter mit hochtrainierten Pferden konkurrieren und zusammen eins werden”. Aber wenn man bedenkt, welche Vorwürfe der Tierquälerei diesem Sport gegenüber bestehen ( https://www.theguardian.com/uk/2010/jan/03/olympics-row-over-horse-cruelty ), sollte die Beschreibung vielleicht eher in “das Brechen des Instinkts und des Körpers eines Pferdes, zumeist durch tyrannische Trainingstechniken” geändert werden.
Die Dressur ist ein Artefakt der mittelalterlichen Kriegsführung, als Pferde in die Schlacht geritten wurden, und wird heute hauptsächlich von den Reichen gepflegt. Dieser manchmal auch als “klassisches Reiten” bezeichnete Reitstil zeichnet sich dadurch aus, dass Pferd und Reiter vorchoreografierte Bewegungen ausführen, die auf gruselige Weise an eine Kindertanzaufführung erinnern. Die Teilnehmer werden auf einer Skala von eins bis zehn nach Kriterien wie Rhythmus, Entspannung, Geradlinigkeit und Antrieb, Dynamik bewertet.
Doch was die Zuschauer hinter den perfekt geflochtenen Mähnen und makellosen Reithosen nicht sehen, ist eine Subkultur der körperlichen und seelischen Misshandlung. In extremen Fällen wurden Ausbilder dabei beobachtet, wie sie ihre Pferde mit Peitschen und Stöcken zur Unterwerfung zwangen. Tierschutzbeauftragte, die 2002 von British Dressage ernannt wurden, wurden Zeuge, wie Reiter ihre Pferde in der Arena bestraften, indem sie gewaltsam an den Zügeln zogen, ohne einen Verweis zu befürchten. Andere haben gesehen, wie frustrierte Reiter ihre Pferde mit Sporen bis zum Bluten traktierten.
Im Jahr 2012 protestierten zahlreiche Menschen gegen die Olympischen Sommerspiele in London, nachdem ein YouTube-Video gezeigt hatte, wie der schwedische Jockey Patrik Kittel die “Rollkur”-Technik anwandte – eine umstrittene Praxis, bei der die Pferde dazu gebracht werden, ihren Hals in Richtung Brust zu biegen – während der Reiter auf seinem Pferd sitzt.
Selbst wenn der Missbrauch nicht absichtlich erfolgt, wie viele Leistungssportler bestätigen wollen, fordert dennoch der Stress des harten Trainings seinen Tribut.
Hinzu kommt, dass der Reitsport als Elitesport wahrgenommen wird. […] Schauen Sie sich die Menschenmenge bei jeder Pferdesportveranstaltung an, und Sie sehen die Gesichter von Milliardären, Blaublütlern und einer soliden Repräsentation des einen Prozents sehen. (Nebenbei bemerkt: Ich habe versucht, Zahlen über Vielfalt im Dressursport zu finden, bin aber nur auf diesen einen kurzen Erguss über die Bedeutung der Diversity im Reitsport gestoßen).
Tausende von Ihnen werden diese Woche wieder die Reitsportveranstaltungen verfolgen und hoffen, die magische Einheit von Pferd und Mensch bewundern zu dürfen. Seit Jahrhunderten symbolisieren Pferde eine einzigartige Art der Freiheit und der ungebändigten Schönheit, die in einigen Kulturen sogar als göttlich betrachtet wird.
Aber anstatt die naturgegebene Majestät der PFerde zu betrachten, werden Sie das Ergebnis eines gebrochenen Geistes sehen können. Genießen Sie also das “horse ballet”, aber wenn Sie sich danach etwas schlecht fühlen, dann wissen Sie warum.
Berichtigung: In einer früheren Version dieses Artikels wurden Tennessee Walking Horses, eine ‘Gangpferderasse’, die manchmal in der Dressur eingesetzt wird, mit Dressurpferden verwechselt, und ein Video über Missbrauch von Pferden wurde fälschlicherweise dem Dressursport zugeordnet. Dieser Fehler wurde korrigiert, um einer genauen Berichterstattung über Grausamkeiten im Dressursport Rechnung zu tragen.
Quelle: Sarah N. Emerson für das Vice-Magazin > August 11, 2016 > https://www.vice.com/en/article/mg75jx/why-is-dressage-still-an-olympic-sport-equestrian [Zugriff 15.01.24]
Übersetzung: Gruppe Messel
rev. 22.01.24